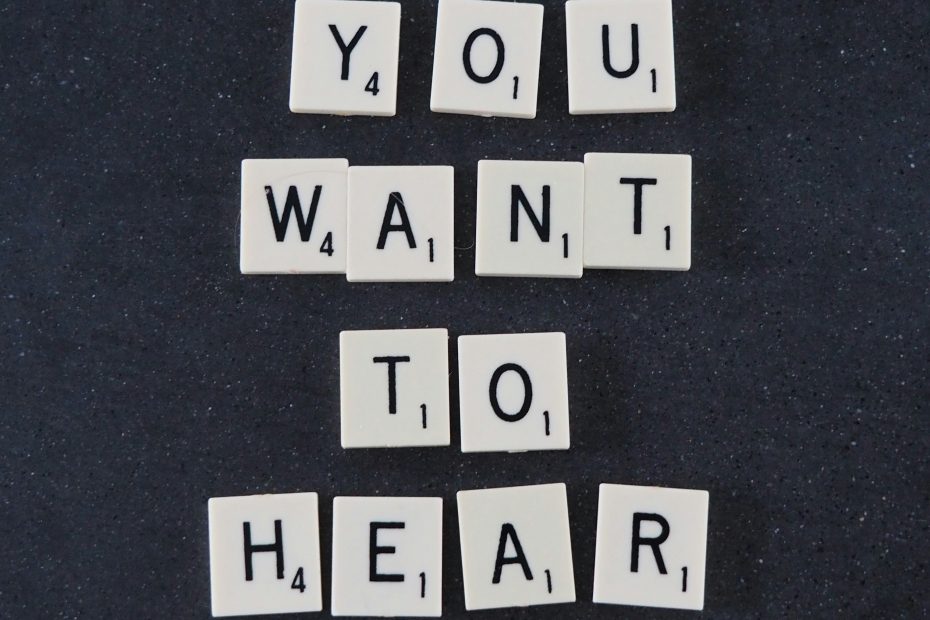Frühling 2024. Die Magnolienbüsche und Bäume am Dom trotzen den Krisen in der Welt. Blühen auf und dagegen an.
Ich mag mich heute wieder mal ganz bewusst anrufen lassen, “auf-hören” und anhalten, nach außen hören, mich erreichen lassen von Stimmen, die vielleicht etwas anderes sagen als das Erwartbare (Hartmut Rosa). In dieser Haltung, draußen auf freier Fläche neben einer alten Kirchenbank zu stehen, fühlt sich ein bißchen an wie Aprilwetter. Unberechenbar. So gestimmt, rolle ich mit der Bank Richtung Münsterplatz und komme mir vor wie eine Frau, die einen Kinderwagen schiebt, einen Marktstand aufbaut oder ein Moped ohne Zündung aus der Garage fährt.
Mein erster Gesprächspartner ist ein älterer Herr mit Rollator, der mir eine kleine Lehrstunde im Hören und Sprechen erteilt. Er fragt mich, was ich denn da so mache mit der Bank. Und ich erkläre ihm, was es damit auf sich hat und dass es ums Zuhören geht, Er zeigt auf seine Ohren und die dahinter versteckten Hörgeräte und bittet mich langsamer zu reden, neigt sein Ohr in Richtung meines Kopfes und sagt: „ Ich höre Sie nicht. Nicht lauter! Langsamer! Das verstehen die meisten Menschen nicht, wenn sie mit Schwerhörigen reden.“ Die kleine Begegnung hat mich nachdenklich gemacht und führt mich zu der Frage:
Was brauchen wir, damit wir nicht nur uns selbst, sondern die Anderen hören, was brauchen sie, damit sie uns hören und wir einen „Resonanzboden“ schaffen können? Ein Resonanzboden, auf dem sich die Dialogpartner entgegengehen können. Wo der Moment entsteht, in dem Veränderung möglich wird und wo etwas in Bewegung kommt. Dafür braucht es nicht nur die Ohren und Stimmen, sondern vor allem die hörenden Herzen, die die Zwischentöne hören, die etwas über die Emotionen und Befindlichkeiten des Gegenübers aussagen. Sich einlassen. Nicht weg hören und drüber weg reden. Eingelassenheit. In unserer aggressiven politischen und gesellschaftlichen Debattenkultur ein seltener Zustand, in den wir nicht hinein kommen, weil wir unsere Ohren zu schnell verschliessen und zu laut reden.
Für die Schaffung von “Resonanz, die als Transformation“ daher kommt, braucht es daher , so der renommierte Jenaer Soziologeprofessor Hartmut Rosa:
„Rückbesinnung auf die Fähigkeit der Anrufbarkeit und die Erfahrung einer „ergebnisoffenen Selbstwirksamkeit, die uns aus dem Aggressionsmodus austreten lässt, für einen Moment nicht zu fragen: Was habe ich davon, was beherrsche ich, was kontrolliere ich? Vielleicht kann man sagen, es braucht ein Sich-nackt-machen, man muss sich berührbar machen, und das heisst immer auch, sich verletzlich machen. (zit. n. Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion, Kösel Verlag)
Und des weiteren, so der Autor, Räume. Räume, die die Erfahrbarkeit von Gott als „vertikales Resonanzversprechen“ bieten: „Am Grund meiner Existenz liegt nicht das schweigende, kalte, feindliche oder gleichgültige Universum‘“ oder der pure Zufall, sondern eine Antwortbeziehung „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein“. was meint, dass es einen gibt, der dir Antwort gibt und dich meint. Religion und gerade das Christentum schafft mit seinen Traditionen und Riten die Möglichkeit, „einen Sinn dafür zu öffnen, was es heisst, sich anrufen zu lassen, sich transformieren zu lassen, und in Resonanz zu stehen“ (Hartmut Rosa).
Neben dem älteren Herrn am Rollator sind mir noch andere Menschen begegnet. Manche sind achtlos an mir vorbeigezogen oder winkten ab, manche liessen sich ansprechen, oder kamen auf mich zu. Hier ein paar Auszüge aus meinen „Kirchenbank-Hörbuch“ von diesem Tag. Mit Ohr und Herzensohr gehört und den „Resonanzversuch“ gestartet: O-Töne:
- Ein Ehepaar aus Norddeutschland, evangelisch:„Wir brauchen weniger Bürokratie und weniger Selbstbeschäftigung im Inner Circle von Kirche. Unsere erwachsenen Kinder sind zwar christlich erzogen, aber Glauben ist unter vielen jungen Familien ja überhaupt kein Thema mehr“ . Ihre Kirchenbank-Aktion spricht mich sehr an. Das finde ich gut!”
- Eine Passantin:„Ich bin glücklich zufrieden, schaue mir die Welt draußen aber gar nicht mehr an, sehe auch keine Nachrichten mehr. Glaube: wozu auch? Wenn ich das ganze Elend in der Welt sehe, zeigt das doch, dass es keinen Gott geben kann. Sonst sähe es bei uns anders aus. Ich kümmere mich um meine schwerkranke Schwester. Menschlichkeit ist wichtig. Dankbarkeit ist wichtig, Dankbarkeit für das, was man hat.“
- „Ich bin Muslima komme aus Nigeria, wohne schon lange in Deutschland, habe muslimische, christliche und nichtgläubige Menschen als Freunde. Wir haben doch alle einen gemeinsamen Ursprung und müssen deshalb gut zusammenhalten“
- Zwei junge Männer, auf der Suche nach den Spuren Karl des Großen, fragen mich nach Museen, Ausstellungen, Thema Religion bleibt außen vor. Zum Abschied beim Weitergehen ein an mich gerichtetes „Shalom“.
- Ältere Postbotin, mit Postlastenrad unterwegs: „Es fehlt der Respekt von Kunden. Wenn ich ausliefere, werde ich manchmal beschimpft, die Arbeit fällt mit fortgeschrittenem Alter immer schwerer. Mit Glauben habe ich nichts am Hut. Wohnungsfindung mit kleinem Einkommen ist fast unmöglich, Geflüchtete werden bei allem bevorzugt.“
- Zwei Aktive in der ehrenamtlichen Gemeindearbeit: „Bistumprozesse thematisieren jahrelang Neuerungen, die an vielen Stellen längst in der Umsetzung sind. Kirche bekommt an einzelnen Orten seit langem Aufwind, man wächst zusammen, wird kreativ und dann wird wieder eine große Struktur auf diese kleinen, aber fruchtbaren Orte drauf gesetzt. Da fühlt man sich überhört.”
- Ehepaar: „Sie können die Welt auch nicht ändern. Es braucht in unserer älter werdenden Gesellschaft viel mehr Seniorenseelsorge“
Eine Reisegruppe von englischen Männern aus Liverpool läuft vorbei. Ein Mann aus der Gruppe hält an, sieht das Buch „Imagine“ auf der Bank liegen. „Oh, Imagine, sagt er. John Lennon is here“. Oh, antworte ich. Jürgen Klopp is in Liverpool. Wir schauen uns an und lachen, bevor er schnell weiterzieht.
Margit Umbach
Foto: Mark Paton on unsplash